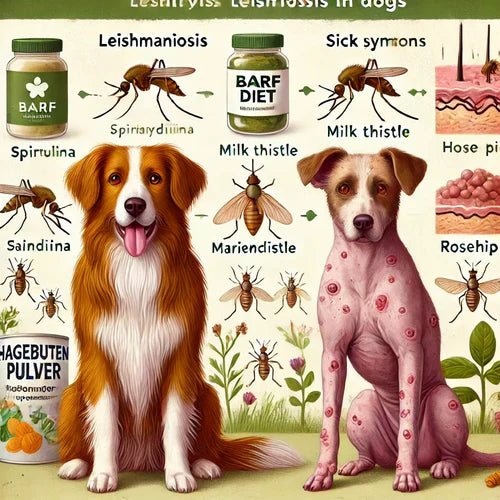Symptome: Zwingerhusten (Infektiöse Tracheobronchitis) zeigt sich durch anhaltenden, trockenen Husten, der oft mit Würgen oder Erbrechen verbunden ist. Betroffene Hunde haben meist einen klaren Appetit und bleiben aktiv, können jedoch Anzeichen von Unwohlsein zeigen. In einigen Fällen kann der Husten auch zu einer schleimigen Nasenabsonderung oder leichtem Fieber führen.
Ursachen: Zwingerhusten wird durch eine Vielzahl von Viren und Bakterien verursacht, darunter das Bordetella bronchiseptica-Bakterium und das Canine Parainfluenzavirus. Die Krankheit wird durch direkten Kontakt zwischen Hunden über Tröpfcheninfektion (z.B. Husten, Niesen) oder über kontaminierte Oberflächen wie Hundehütten oder -plätze übertragen. Besonders in Tierheimen, Zwingern oder bei Hundeveranstaltungen, wo viele Hunde auf engem Raum zusammenkommen, ist die Ansteckungsgefahr hoch.
Vorbeugung: Die Impfung gegen Bordetella bronchiseptica und Parainfluenzavirus ist eine wichtige präventive Maßnahme. Besonders Hunde, die häufig in großen Gruppen oder an Orten mit vielen anderen Hunden (wie Zwinger, Tierpensionen oder Hundeschulen) sind, sollten geimpft werden. Regelmäßige Hygiene und das Vermeiden von engem Kontakt zu kranken Hunden helfen ebenfalls, das Risiko zu verringern.
Behandlung: Zwingerhusten ist in der Regel selbstlimitierend und heilt in den meisten Fällen von selbst innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Die Behandlung konzentriert sich darauf, die Symptome zu lindern, beispielsweise durch Hustenmittel und gegebenenfalls Antibiotika, um sekundäre bakterielle Infektionen zu verhindern. In schweren Fällen kann eine unterstützende Behandlung wie Inhalationstherapie oder Antibiotikagabe erforderlich sein. Bei Welpen, älteren Hunden oder Hunden mit geschwächtem Immunsystem kann die Erkrankung schwerer verlaufen, sodass eine frühzeitige tierärztliche Betreuung ratsam ist.
Mehr über Zwingerhusten
Befall mit Parasiten
Symptome: Ein Parasitenbefall bei Hunden kann sich auf verschiedene Weisen zeigen, je nach Art des Parasiten. Häufige Symptome sind Juckreiz, Haarausfall, Hautirritationen oder Wunden, ständiges Kratzen oder Beißen an bestimmten Stellen des Körpers. Innerliche Parasiten wie Würmer können zu Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, aufgeblähtem Bauch oder Müdigkeit führen. Auch Blut im Stuhl oder in Erbrochenem kann ein Anzeichen für einen Parasitenbefall sein.
Ursachen: Hunde können sich durch Kontakt mit infizierten Tieren, verunreinigtem Wasser, Erde oder durch das Aufnehmen von Eiern oder Larven von Parasiten anstecken. Zu den häufigsten Parasiten gehören Flöhe, Zecken, Milben, Würmer (z.B. Rundwürmer, Bandwürmer, Hakenwürmer), Giardien (Einzeller) und Toxoplasmen. Diese Parasiten können sowohl äußerlich (auf der Haut) als auch innerlich (im Verdauungstrakt oder anderen Organen) vorkommen.
Vorbeugung: Regelmäßige Entwurmungen, je nach Risikofaktoren und den Empfehlungen des Tierarztes, sind wichtig, um innerliche Parasiten zu vermeiden. Für äußere Parasiten wie Flöhe und Zecken gibt es Präventionsmittel in Form von Spot-Ons, Tabletten oder Halsbändern. Die Hygiene des Hundes und seines Umfelds ist ebenfalls entscheidend. Das Vermeiden von Kontakt mit kranken Tieren, das gründliche Abwischen der Pfoten nach Spaziergängen und das Sauberhalten von Schlafplätzen und Spielzeugen helfen, Parasitenbefall zu reduzieren.
Behandlung: Je nach Art des Parasiten erfolgt die Behandlung mit speziellen Medikamenten, die vom Tierarzt verschrieben werden. Für Flöhe gibt es Insektizide, für Würmer werden Entwurmungsmittel verwendet. Bei Zeckenbefall sollten diese schnell entfernt werden, um das Risiko von Krankheiten wie Borreliose oder Anaplasmose zu verringern. In einigen Fällen kann auch eine Behandlung des gesamten Umfelds (z.B. durch Flohschutzsprays oder -pulver) notwendig sein, um eine Reinfektion zu vermeiden.
Mehr über den Befall mit Parasiten
Ohrenentzündung (Otitis externa)
Symptome: Eine Ohrenentzündung (Otitis externa) bei Hunden äußert sich durch Rötung, Schwellung und vermehrte Absonderung im Gehörgang, die oft einen unangenehmen Geruch haben kann. Der Hund kratzt häufig an den Ohren, schüttelt den Kopf oder zeigt Anzeichen von Schmerzen beim Berühren des Ohres. In schweren Fällen kann es zu einer Veränderung der Ohrmuschel oder sogar zu einer erhöhten Temperatur und Appetitlosigkeit kommen.
Ursachen: Otitis externa wird oft durch eine bakterielle oder pilzliche Infektion verursacht, die durch eine Vielzahl von Faktoren begünstigt wird. Dazu gehören Feuchtigkeit im Ohr (z.B. nach dem Schwimmen), Allergien, Parasiten wie Ohrmilben, zu häufige oder falsche Reinigung der Ohren sowie anatomische Faktoren wie enge oder stark behaarte Gehörgänge. Auch eine schlechte Hygiene oder eine geschwächte Immunabwehr können das Risiko für eine Ohrenentzündung erhöhen.
Vorbeugung: Um einer Ohrenentzündung vorzubeugen, sollten die Ohren des Hundes regelmäßig auf Schmutz oder Feuchtigkeit überprüft werden, besonders nach dem Schwimmen oder Spaziergängen im Regen. Eine regelmäßige, aber behutsame Reinigung mit speziellen Ohrreinigungsmitteln kann helfen, Ablagerungen zu entfernen und Infektionen vorzubeugen. Hunde mit langem, behaartem Gehörgang sollten häufiger kontrolliert und bei Bedarf geschnitten werden. Bei anfälligen Hunden kann auch eine Behandlung von Allergien notwendig sein.
Behandlung: Die Behandlung einer Ohrenentzündung hängt von der Ursache ab. Bei einer bakteriellen oder pilzlichen Infektion werden häufig Ohrentropfen oder -salben mit Antibiotika oder Antimykotika eingesetzt. In einigen Fällen sind auch Schmerzmittel notwendig, um die Beschwerden zu lindern. Bei Ohrmilben wird eine spezifische Behandlung mit geeigneten Medikamenten verordnet. Wenn der Hund unter wiederholten oder chronischen Ohrenentzündungen leidet, sollte ein Tierarzt die zugrunde liegende Ursache (z.B. Allergien oder anatomische Probleme) ermitteln und eine langfristige Behandlungsstrategie entwickeln.
Mehr über die Ohrenentzündung
Allergien und Hautausschlag
Symptome: Allergien bei Hunden können sich auf unterschiedliche Weise zeigen, häufig jedoch in Form von Hautausschlägen, Juckreiz, Rötung und Schwellung. Der Hund kratzt sich häufig, beißt oder leckt an betroffenen Stellen. Hautausschläge können sich als kleine, rote Pusteln oder als flache, nässende Stellen zeigen. Auch Haarausfall und trockene, schuppige Haut sind häufige Symptome. Manchmal können allergische Reaktionen auch Atemprobleme, Verdauungsstörungen oder Ohrentzündungen verursachen.
Ursachen: Allergien bei Hunden können durch verschiedene Auslöser hervorgerufen werden. Dazu gehören Umwelteinflüsse wie Pollen, Staubmilben oder Schimmel (saisonale oder ganzjährige Allergien), sowie Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder -allergien (z.B. gegen bestimmte Eiweiße wie Huhn oder Rind). Auch Flohbisse oder eine überempfindliche Reaktion auf bestimmte chemische Stoffe in Pflegeprodukten oder Reinigungsmitteln können Hautausschläge und Allergien auslösen.
Vorbeugung: Um Allergien vorzubeugen, sollten Hunde mit bekannten Allergien regelmäßig auf Auslöser untersucht werden. Bei Nahrungsmittelallergien kann eine spezielle hypoallergene Diät helfen. Bei Umwelteinflüssen kann es sinnvoll sein, die betroffenen Bereiche regelmäßig zu reinigen und den Hund während der Hochsaison von Allergenen fernzuhalten. Flohprävention und die Verwendung von allergenfreien Pflegeprodukten können ebenfalls hilfreich sein.
Behandlung: Die Behandlung von Hautallergien und -ausschlägen erfolgt häufig durch die Gabe von Antihistaminika oder Kortikosteroiden, um den Juckreiz und die Entzündung zu lindern. In einigen Fällen können auch spezielle Hautshampoos oder Salben verwendet werden, um die Haut zu beruhigen und eine Heilung zu fördern. Wenn der Auslöser der Allergie identifiziert werden kann (z.B. durch einen Allergietest oder eine Ausschlussdiät), sollte der Hund von diesem Faktor ferngehalten werden. In schweren Fällen oder bei chronischen Allergien kann eine spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) in Erwägung gezogen werden.
Mehr über Allergien und Hautausschlag
Blasenentzündung (Cystitis)
Symptome: Eine Blasenentzündung (Cystitis) bei Hunden äußert sich durch häufiges, schmerzhaftes Urinieren, oft in kleinen Mengen. Der Hund kann sich wiederholt in der Nähe des Katzenklos oder an anderen Stellen zum Urinieren aufhalten, ohne dass viel Urin abgegeben wird. Weitere Anzeichen sind Blut im Urin, trüber oder übel riechender Urin, Lecken am Genitalbereich und möglicherweise auch vermehrtes Trinken. In schweren Fällen kann der Hund Anzeichen von Schmerzen beim Urinieren oder ein allgemeines Unwohlsein zeigen.
Ursachen: Cystitis kann durch bakterielle Infektionen, Harnsteine, Tumore, Verletzungen oder andere gesundheitliche Probleme verursacht werden. Bakterien wie Escherichia coli sind häufige Auslöser. Auch Harnwegsinfektionen (UTIs) oder Blasensteine können die Blasenwand reizen und eine Entzündung hervorrufen. Darüber hinaus können hormonelle Veränderungen, wie sie nach einer Kastration auftreten können, oder Probleme wie Inkontinenz die Wahrscheinlichkeit einer Blasenentzündung erhöhen.
Vorbeugung: Um einer Blasenentzündung vorzubeugen, ist es wichtig, dass der Hund ausreichend trinkt und regelmäßig seine Blase entleert. Der Urin sollte nicht zu lange zurückgehalten werden. Die Hygiene im Bereich der Geschlechtsorgane sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Für Hunde, die zu wiederholten Harnwegsinfektionen neigen, können regelmäßige Tierarztbesuche und präventive Behandlungen sinnvoll sein.
Behandlung: Eine Blasenentzündung wird in der Regel mit Antibiotika behandelt, wenn sie durch eine bakterielle Infektion verursacht wird. Die genaue Wahl des Antibiotikums richtet sich nach dem Erreger, der durch eine Urinprobe festgestellt werden kann. Bei Harnsteinen oder anderen strukturellen Problemen muss die zugrunde liegende Ursache behandelt werden, was eine Ernährungsumstellung oder sogar eine Operation erfordern kann. In einigen Fällen werden entzündungshemmende Medikamente eingesetzt, um die Symptome zu lindern. Es ist wichtig, die gesamte Behandlung abzuschließen, um Rückfälle zu vermeiden und eine vollständige Heilung sicherzustellen.
Mehr über Blasenentzündung
Räude (Sarcoptesräude)
Symptome: Räude, auch bekannt als Sarcoptesräude, zeigt sich durch starken Juckreiz, Haarausfall und Rötungen der Haut. Der Hund kratzt sich intensiv und beißt häufig an den betroffenen Stellen, was zu offenen Wunden und Hautentzündungen führen kann. Besonders häufig sind die Ohren, Ellbogen, Bauch und Pfoten betroffen. Die Haut kann verdickt und schuppig erscheinen. In schweren Fällen kann es zu einer allgemeinen Verschlechterung des Gesundheitszustands kommen, einschließlich Fieber, Appetitlosigkeit und Erschöpfung.
Ursachen: Sarcoptesräude wird durch den Hautparasit Sarcoptes scabiei verursacht, der in die obersten Hautschichten eindringt und dort Gänge gräbt. Die Milben ernähren sich von Hautzellen und verursachen dabei eine starke allergische Reaktion des Hundes, die zu Juckreiz und Entzündungen führt. Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch den Kontakt mit kontaminierten Gegenständen oder Oberflächen.
Vorbeugung: Da Sarcoptesräude hoch ansteckend ist, ist es wichtig, den Kontakt mit infizierten Tieren zu vermeiden. Hunde, die häufig mit anderen Hunden in Kontakt kommen (z.B. in Tierheimen oder auf Hundetagen), haben ein höheres Risiko, sich anzustecken. Eine gute Hygiene, die regelmäßige Pflege des Hundes und das Vermeiden von Kontakt zu Tieren, von denen bekannt ist, dass sie Räude haben, sind wichtige Präventionsmaßnahmen.
Behandlung: Die Behandlung der Sarcoptesräude erfolgt in der Regel mit speziellen Präparaten, die Milben abtöten. Dazu gehören topische Behandlungen (wie Shampoos oder Spot-ons) oder orale Medikamente, die vom Tierarzt verschrieben werden. In vielen Fällen sind mehrere Behandlungen erforderlich, um alle Milben abzutöten und eine erneute Infektion zu verhindern. Es können auch entzündungshemmende Medikamente verordnet werden, um den Juckreiz und die Entzündung zu lindern. Da die Räude sehr ansteckend ist, sollten auch andere Tiere im Haushalt behandelt werden, um eine Verbreitung zu verhindern.
Mehr über Räude
Staupe
Symptome: Staupe (Canine Distemper) ist eine sehr ernsthafte Viruskrankheit, die durch das Canine Distemper Virus (CDV) verursacht wird. Die Symptome können in verschiedenen Stadien auftreten und betreffen verschiedene Organsysteme. Zu den ersten Anzeichen gehören Fieber, Appetitlosigkeit, Husten, vermehrter Ausfluss aus den Augen und der Nase sowie eine starke Müdigkeit. Im fortgeschrittenen Stadium können neurologische Symptome wie Krampfanfälle, Zittern, Lähmungen und Koordinationsstörungen hinzukommen. In einigen Fällen zeigt der Hund eine starke Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen oder Berührungen.
Ursachen: Staupe wird durch das Canine Distemper Virus (CDV) verursacht, das durch Tröpfcheninfektion (z.B. Husten, Niesen) von infizierten Hunden übertragen wird. Es betrifft hauptsächlich Hunde, die nicht gegen das Virus geimpft sind. Besonders gefährdet sind Welpen, ältere Hunde oder Hunde mit geschwächtem Immunsystem.
Vorbeugung: Die Impfung ist die wirksamste Methode zur Vorbeugung von Staupe. Welpen sollten mit etwa 6-8 Wochen die erste Impfung gegen Staupe erhalten und anschließend regelmäßig aufgefrischt werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Hunde, die mit vielen anderen Hunden in Kontakt kommen (z.B. in Tierheimen oder auf Hundeveranstaltungen), sind einem höheren Risiko ausgesetzt und sollten besonders gut geschützt werden.
Behandlung: Es gibt keine spezifische Heilung für Staupe, aber die Behandlung konzentriert sich auf die Linderung der Symptome und die Unterstützung des Immunsystems. In der Regel werden fiebersenkende Medikamente, Antibakterien zur Vorbeugung sekundärer bakterieller Infektionen und gegebenenfalls antivirale Mittel eingesetzt. Bei neurologischen Symptomen können spezielle Medikamente zur Linderung von Krampfanfällen und Zittern erforderlich sein. In schweren Fällen kann eine intensivmedizinische Betreuung notwendig sein. Leider ist die Krankheit häufig tödlich, besonders bei nicht geimpften Tieren oder Welpen. Eine frühe Diagnose und sofortige tierärztliche Behandlung sind entscheidend, um die Überlebenschancen zu erhöhen.
Mehr über Staupe
Zahnkrankheiten
Zahnstein
Symptome: Zahnstein bei Hunden äußert sich durch bräunliche oder gelbe Ablagerungen auf den Zähnen, die besonders entlang des Zahnfleischrandes sichtbar sind. Zu den typischen Symptomen gehören ein unangenehmer Mundgeruch (Halitosis), Rötungen oder Schwellungen des Zahnfleisches (Gingivitis), vermehrtes Speicheln, Schwierigkeiten beim Kauen und manchmal auch Zahnlockerung. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Zahnfleischbluten oder sogar zu Zahnausfall kommen.
Ursachen: Zahnstein entsteht, wenn Plaque (eine Mischung aus Bakterien, Speiseresten und Speichel) auf den Zähnen nicht regelmäßig entfernt wird. Die Plaque verhärtet sich mit der Zeit und bildet Zahnstein, der sich fest an den Zähnen anlagert. Zu den Hauptursachen gehören eine unzureichende Zahnpflege, falsche Ernährung (insbesondere weiche oder zuckerhaltige Futtermittel), genetische Veranlagung und unregelmäßige tierärztliche Kontrollen der Zähne.
Vorbeugung: Zahnstein kann durch regelmäßige Zahnpflege verhindert oder zumindest verzögert werden. Dazu gehört das tägliche Zähneputzen mit einer speziellen Hundezahnbürste und Zahnpasta, die für Hunde geeignet ist. Auch das Geben von zahnreinigenden Snacks oder Kaumaterialien, wie spezielle Kauspielzeuge oder -knochen, kann helfen, Plaque zu reduzieren. Eine ausgewogene Ernährung, die die Zähne durch natürliche Kaubewegungen reinigt, kann ebenfalls zur Zahngesundheit beitragen. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen der Zähne sind wichtig, um Zahnstein frühzeitig zu erkennen.
Behandlung: Zahnstein kann nur durch professionelle Zahnreinigung beim Tierarzt entfernt werden. Diese erfolgt in der Regel unter Vollnarkose, da die Zähne gründlich gereinigt und der Zahnstein auch unterhalb des Zahnfleischrands entfernt werden muss. In manchen Fällen wird zusätzlich eine Zahnbehandlung nötig, wenn es zu einer Zahnfleischentzündung (Gingivitis) oder Parodontalerkrankung gekommen ist. Um die Bildung von Zahnstein in Zukunft zu verhindern, wird empfohlen, regelmäßig die Zähne zu putzen und bei Bedarf eine Zahnpflegeberatung beim Tierarzt einzuholen.
Mehr über Zahnstein
Parodontitis
Symptome: Parodontitis ist eine fortgeschrittene Zahnfleischerkrankung, die durch Entzündungen des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparates gekennzeichnet ist. Zu den typischen Symptomen gehören starkes Zahnfleischbluten, insbesondere beim Kauen oder Zähneputzen, Rötungen und Schwellungen des Zahnfleisches, Mundgeruch (Halitosis), Rückgang des Zahnfleisches, Zahnlockerung und vermehrtes Speicheln. Der Hund könnte auch Schmerzen beim Kauen zeigen oder Schwierigkeiten haben, feste Nahrung zu fressen.
Ursachen: Parodontitis wird durch eine fortschreitende Entzündung des Zahnfleisches verursacht, die oft auf unbehandelten Zahnstein oder Plaque zurückzuführen ist. Bakterien aus der Plaque dringen in das Zahnfleisch ein und führen zu einer Entzündung des Zahnhalteapparates. Wenn die Entzündung unbehandelt bleibt, kann sie das Zahnfleisch, den Knochen und die Bänder, die die Zähne halten, dauerhaft schädigen. Zu den Risikofaktoren gehören mangelnde Zahnpflege, eine falsche Ernährung (insbesondere weiches oder zuckerhaltiges Futter) und genetische Veranlagung.
Vorbeugung: Die beste Prävention gegen Parodontitis ist eine regelmäßige Zahnpflege. Dazu gehört das tägliche Zähneputzen mit einer speziellen Hundezahnbürste und Zahnpasta, die für Hunde geeignet ist. Das Geben von Kauspielzeug oder zahnreinigenden Snacks kann helfen, Plaque und Zahnstein zu reduzieren. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen der Zähne und professionelle Zahnreinigungen beim Tierarzt sind wichtig, um Zahnstein frühzeitig zu entfernen und Parodontitis vorzubeugen. Auch eine ausgewogene Ernährung, die die Zähne stärkt, kann zur Zahngesundheit beitragen.
Behandlung: Die Behandlung von Parodontitis erfolgt in der Regel durch eine gründliche Zahnreinigung beim Tierarzt, um Zahnstein und Plaque zu entfernen. In schweren Fällen kann es notwendig sein, betroffene Zähne zu extrahieren, wenn sie stark gelockert oder von Entzündungen betroffen sind. Bei einer fortgeschrittenen Parodontitis wird häufig eine umfassende Behandlung der Zahnfleischtaschen erforderlich, um die Entzündung zu bekämpfen und das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen. Schmerzmedikamente und Antibiotika können ebenfalls eingesetzt werden, um die Entzündung zu lindern und eine Infektion zu verhindern.
Mehr über Parodontitis
Übergewicht
Herz- und Kreislaufprobleme
Symptome: Herz- und Kreislaufprobleme bei Hunden äußern sich häufig durch verschiedene Symptome, die mit der Blutzirkulation und der Funktion des Herzens zusammenhängen. Zu den häufigsten Anzeichen gehören eine verringerte Leistungsfähigkeit, schnelle Ermüdung, Husten (besonders nachts oder nach körperlicher Anstrengung), Atemnot oder eine erhöhte Atemfrequenz. Auch ein geschwollener Bauch (durch Flüssigkeitsansammlungen), eine bläuliche Färbung der Zunge oder des Zahnfleisches (Zyanose), Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust oder allgemeines Unwohlsein können auf Herzprobleme hinweisen. In fortgeschrittenen Fällen können Hunde sogar in Ruhe eine beschleunigte Atmung oder eine unregelmäßige Herzfrequenz zeigen.
Ursachen: Herz- und Kreislaufprobleme bei Hunden können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, darunter genetische Veranlagung, Alter, Übergewicht, schlechte Ernährung und eine unzureichende Bewegung. Zu den häufigsten Erkrankungen gehören Herzinsuffizienz (Herzschwäche), Mitralklappeninsuffizienz (defekte Herzklappen), Herzrhythmusstörungen (z.B. Vorhofflimmern) und Herzparasiten wie Dirofilaria immitis (Herzwürmer). Auch Bluthochdruck, eine vergrößerte Herzmuskelwand (Kardiomyopathie) und angeborene Herzfehler gehören zu den häufigen Ursachen für Herz- und Kreislaufprobleme.
Vorbeugung: Eine gesunde Lebensweise ist entscheidend für die Vorbeugung von Herz- und Kreislaufproblemen. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung, die das Herz des Hundes unterstützt, regelmäßige Bewegung und das Vermeiden von Übergewicht. Zudem ist es wichtig, den Hund regelmäßig beim Tierarzt untersuchen zu lassen, um mögliche Herz- oder Kreislauferkrankungen frühzeitig zu erkennen. Insbesondere bei älteren Hunden oder Hunden mit einer genetischen Prädisposition sollte das Herz regelmäßig überprüft werden. Die Behandlung von Herzwürmern durch vorbeugende Medikamente kann ebenfalls zur Vermeidung von Kreislaufproblemen beitragen.
Behandlung: Die Behandlung von Herz- und Kreislaufproblemen richtet sich nach der spezifischen Erkrankung und dem Schweregrad. Bei Herzinsuffizienz können Medikamente wie ACE-Hemmer, Diuretika (Entwässerungsmittel) und Beta-Blocker eingesetzt werden, um das Herz zu entlasten und den Blutdruck zu regulieren. Bei Herzrhythmusstörungen kommen in der Regel spezielle Medikamente zum Einsatz, die den Herzrhythmus stabilisieren. Wenn Herzwürmer die Ursache sind, erfolgt eine Entwurmungstherapie. In manchen Fällen kann eine Operation notwendig sein, insbesondere bei angeborenen Herzfehlern oder bei stark geschädigten Herzklappen. Regelmäßige Kontrollen und eine angepasste Behandlung sind wichtig, um die Lebensqualität des Hundes zu erhalten und das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern.
Mehr über Herz- und Kreislauferkrankungen
Diabetes mellitus
Symptome: Diabetes mellitus bei Hunden zeigt sich durch verschiedene Symptome, die mit einer schlechten Blutzuckerregulation zusammenhängen. Zu den häufigsten Anzeichen gehören vermehrtes Trinken (Polydipsie), häufiges Wasserlassen (Polyurie), erhöhter Appetit (Polyphagie) und unerklärlicher Gewichtsverlust. In einigen Fällen kann der Hund auch lethargisch oder schwach erscheinen, und seine Fellqualität kann sich verschlechtern. Bei nicht behandelten oder fortgeschrittenen Fällen können auch Symptome wie Erbrechen, Dehydration und Koma auftreten.
Ursachen: Diabetes mellitus bei Hunden tritt auf, wenn der Körper entweder nicht genug Insulin produziert oder das Insulin nicht richtig verwendet wird. Insulin ist ein Hormon, das für die Regulierung des Blutzuckerspiegels verantwortlich ist. Es gibt zwei Haupttypen von Diabetes bei Hunden: Typ 1 (die häufigste Form), bei der die Insulinproduktion im Körper gestört ist, und seltener Typ 2, bei dem die Zellen des Hundes insulinresistent werden. Zu den Risikofaktoren gehören Übergewicht, Alter (häufiger bei älteren Hunden), eine genetische Veranlagung (bestimmte Rassen sind anfälliger) und hormonelle Störungen (wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Cushing-Erkrankung).
Vorbeugung: Die Prävention von Diabetes mellitus bei Hunden ist größtenteils auf die Kontrolle von Übergewicht und die Förderung eines gesunden Lebensstils ausgerichtet. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind entscheidend, um den Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten. Es ist auch wichtig, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen durchzuführen, um Frühzeichen von Diabetes zu erkennen, besonders bei Hunden, die genetisch prädisponiert sind oder die Anzeichen von Hormonstörungen zeigen.
Behandlung: Die Behandlung von Diabetes mellitus bei Hunden erfordert in der Regel eine lebenslange Insulintherapie. Hunde mit Diabetes müssen regelmäßig Insulin spritzen, um ihren Blutzuckerspiegel zu regulieren. Die Insulindosis wird individuell angepasst, basierend auf den Blutzuckerwerten, die der Tierarzt regelmäßig überwacht. Darüber hinaus ist es wichtig, eine spezielle Diät zu befolgen, die den Blutzuckerspiegel stabil hält. Futter mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen und niedrigem Fettgehalt kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Die regelmäßige Überwachung des Blutzuckerspiegels und gegebenenfalls Anpassungen der Insulindosis sind entscheidend für die erfolgreiche Behandlung. Bei frühzeitiger Diagnose und konsequenter Behandlung können Hunde mit Diabetes ein relativ normales Leben führen.
Mehr über Diabetes mellitus
Erkrankungen der Knochen und Gelenke
Bandscheibenvorfall
Symptome: Ein Bandscheibenvorfall (Diskushernie) bei Hunden kann sich durch unterschiedliche Symptome äußern, die von der Schwere des Vorfalls und der betroffenen Stelle abhängen. Zu den häufigsten Anzeichen gehören plötzlich auftretende Schmerzen, die oft mit einer starren Haltung, Zittern oder vermehrtem Lecken des betroffenen Bereichs einhergehen. Der Hund kann Schwierigkeiten beim Aufstehen oder Gehen haben, möglicherweise hinken oder den Rücken krümmen. In schwereren Fällen kann es zu Lähmungen der Hinterbeine, Verlust der Blasen- und Darmkontrolle oder einer allgemeinen Schwäche in den Gliedmaßen kommen. Der Hund kann auch mehr als gewöhnlich liegen und Aktivitäten wie Springen oder Treppensteigen meiden.
Ursachen: Ein Bandscheibenvorfall tritt auf, wenn die weiche, gelartige Substanz der Bandscheibe zwischen den Wirbeln aus ihrer normalen Position herausrutscht und auf das Rückenmark oder die Nerven drückt. Dies kann durch plötzliche, starke Belastung, wie z.B. beim Springen oder einem Unfall, verursacht werden. Häufiger sind jedoch degenerative Veränderungen der Bandscheiben im Alter, die die Festigkeit und Flexibilität verringern. Bestimmte Hunderassen, wie Dackel, Bulldoggen und Chihuahua, sind aufgrund ihrer Körperstruktur anfälliger für Bandscheibenvorfälle. Übergewicht und eine mangelnde Bewegung erhöhen ebenfalls das Risiko.
Vorbeugung: Die Vorbeugung eines Bandscheibenvorfalls konzentriert sich auf die Vermeidung von unnötigen Belastungen und die Förderung eines gesunden Lebensstils. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind wichtig, um das Gewicht des Hundes zu kontrollieren und die Muskulatur zu stärken. Vermeiden Sie es, den Hund zum Springen von hohen Stellen oder übermäßigen Belastungen auszusetzen. Wenn Ihr Hund eine Rasse ist, die anfällig für Bandscheibenprobleme ist, achten Sie darauf, keine abrupten Bewegungen oder sportliche Aktivitäten zuzulassen, die zu Verletzungen führen könnten.
Behandlung: Die Behandlung eines Bandscheibenvorfalls hängt von der Schwere der Erkrankung ab. In milden Fällen kann eine konservative Therapie ausreichend sein, die Ruhe, Schmerzmittel (z.B. Entzündungshemmer und Schmerzmittel), Physiotherapie und manchmal Akupunktur umfasst. Bei schweren Fällen, die zu Lähmungen oder schweren Schmerzen führen, ist eine chirurgische Behandlung erforderlich, um den Druck auf das Rückenmark oder die Nerven zu lindern. Eine Bandscheibenoperation kann die Beweglichkeit wiederherstellen und weitere Schäden verhindern. Nach der Behandlung ist eine intensive Rehabilitation wichtig, um die Muskulatur zu stärken und eine vollständige Genesung zu fördern. Regelmäßige Nachkontrollen beim Tierarzt sind entscheidend, um den Fortschritt zu überwachen und die Therapie anzupassen.
Mehr über Bandscheibenvorfall
Hüftgelenkdysplasie
Symptome: Hüftgelenkdysplasie (HD) ist eine häufige Gelenkerkrankung bei Hunden, insbesondere bei größeren Rassen. Sie entsteht, wenn sich das Hüftgelenk nicht richtig entwickelt, was zu einer unvollständigen oder fehlerhaften Passform zwischen dem Oberschenkelknochen und der Hüftpfanne führt. Zu den typischen Symptomen gehören Hinken oder Lahmheit, vor allem nach Bewegung oder längerem Liegen, Schwierigkeiten beim Aufstehen oder Treppensteigen, eine veränderte Gangart (z.B. „Hasenschritte“ oder langsames Gehen), Steifheit oder Schmerzen in den Hüften. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Gelenkgeräuschen, einer Einschränkung der Beweglichkeit und einer veränderten Körperhaltung kommen.
Ursachen: Hüftgelenkdysplasie ist eine genetische Erkrankung, die häufig bei großen Hunderassen wie Deutschen Schäferhunden, Labrador Retrievern, Rottweilern und Bernhardinern auftritt. Die genetische Veranlagung wird durch Umweltfaktoren wie schnelles Wachstum, Übergewicht, falsche Ernährung oder übermäßige körperliche Belastung in jungen Jahren beeinflusst. Diese Faktoren können das Risiko erhöhen, dass sich das Hüftgelenk fehlerhaft entwickelt. Auch hormonelle Ungleichgewichte und schlechte Bewegungserfahrungen in der Wachstumsphase können zur Entstehung von Hüftgelenkdysplasie beitragen.
Vorbeugung: Die Vorbeugung von Hüftgelenkdysplasie konzentriert sich auf eine gesunde Entwicklung des Hundes. Eine ausgewogene Ernährung, die das Wachstum in den ersten Lebensjahren unterstützt und eine übermäßige Gewichtszunahme vermeidet, ist entscheidend. Auch regelmäßige, altersgerechte Bewegung hilft dabei, die Gelenke gesund zu halten und den Hund nicht übermäßig zu belasten. Welpen großer Rassen sollten nicht zu intensiven oder übermäßigen körperlichen Aktivitäten ausgesetzt werden, die zu einer Belastung der Hüftgelenke führen könnten. Es wird auch empfohlen, die Elterntiere von Züchtern auf Hüftdysplasie zu testen, um das Risiko einer genetischen Vererbung zu minimieren.
Behandlung: Die Behandlung der Hüftgelenkdysplasie richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung und kann sowohl konservative als auch chirurgische Maßnahmen umfassen. In milden Fällen kann eine Kombination aus Schmerzmitteln, Entzündungshemmern und Physiotherapie helfen, die Beweglichkeit zu erhalten und die Schmerzen zu lindern. Gewichtskontrolle ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Behandlung, da übermäßiges Gewicht die Gelenke zusätzlich belastet. In schwereren Fällen, wenn die Symptome das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen, können chirurgische Eingriffe notwendig sein, wie z.B. die Umstellung des Hüftgelenks (Triple Pelvic Osteotomy) oder sogar ein Hüftgelenkersatz. Eine regelmäßige physiotherapeutische Behandlung kann auch nach einer Operation dazu beitragen, die Heilung zu fördern und die Beweglichkeit zu verbessern. Eine frühzeitige Diagnose und eine individuell angepasste Behandlung sind entscheidend, um die Lebensqualität des Hundes zu erhalten.
Mehr über Hüftgelenkdysplasie
Arthrose
Symptome: Arthrose bei Hunden zeigt sich durch Gelenkschmerzen, Steifheit, Lahmheit und eine eingeschränkte Beweglichkeit, besonders nach längerem Liegen oder intensiver Bewegung. Der Hund kann sich langsamer bewegen, Schwierigkeiten beim Treppensteigen oder Aufstehen haben und gelegentlich humpeln.
Ursachen: Arthrose entsteht durch den Abbau des Gelenkknorpels, was zu einer schmerzhaften Reibung zwischen den Gelenken führt. Ursachen können Verletzungen, altersbedingte Abnutzung oder Gelenkfehlstellungen (wie Hüftgelenkdysplasie) sein.
Vorbeugung: Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichender Unterstützung für Gelenke, wie Omega-3-Fettsäuren und Glucosamin, hilft, den Knorpel zu schützen. Auch regelmäßige, aber nicht übermäßige Bewegung und Gewichtskontrolle sind wichtig, um die Gelenke zu entlasten und Arthrose vorzubeugen.
Behandlung: Die Behandlung umfasst Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente und ggf. Physiotherapie. Eine spezielle Diät mit Gelenknährstoffen (wie Glucosamin, Chondroitin und Omega-3-Fettsäuren) kann die Gelenkgesundheit unterstützen. In schweren Fällen kann eine Operation notwendig sein.
Mehr über Arthrose
Kreuzbandriss
Symptome: Ein Kreuzbandriss bei Hunden führt zu plötzlicher Lahmheit und Schmerzen, insbesondere bei Belastung des betroffenen Beins. Der Hund kann das betroffene Bein häufig heben, oder es kommt zu einer sichtbaren Instabilität beim Gehen. Es kann auch Schwellungen im Kniebereich auftreten, und der Hund zeigt oft Vermeidungsverhalten bei Aktivitäten wie Laufen oder Springen.
Ursachen: Ein Kreuzbandriss entsteht meist durch plötzliche Bewegungen oder unnatürliche Belastung des Kniegelenks. Häufig betroffen sind Hunde mit Übergewicht, älteren Tieren oder solchen mit genetischer Veranlagung, wie bei bestimmten Rassen (z.B. Labrador Retriever, Bulldoggen).
Vorbeugung: Eine gesunde Gewichtskontrolle, die Vermeidung von übermäßiger Belastung und regelmäßige, moderate Bewegung sind wichtig, um das Risiko eines Kreuzbandrisses zu verringern. Stärkung der Muskulatur durch gezielte Übungen kann ebenfalls helfen, das Gelenk zu stabilisieren.
Behandlung: In der Regel erfordert ein Kreuzbandriss eine chirurgische Behandlung, um das gerissene Band zu reparieren oder zu ersetzen. Es gibt verschiedene Operationsmethoden, wie z.B. die TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) oder TTA (Tibial Tuberosity Advancement). Nach der Operation ist eine intensive Rehabilitationsphase notwendig, um die Beweglichkeit wiederherzustellen und eine erneute Verletzung zu vermeiden.
Mehr über Kreuzbandriss
Spondylose
Symptome: Spondylose ist eine degenerative Veränderung der Wirbelsäule, bei der sich knöcherne Auswüchse (Osteophyten) an den Wirbeln bilden. Symptome können Schmerzen, Steifheit und eine eingeschränkte Beweglichkeit der Wirbelsäule umfassen. Hunde mit Spondylose haben häufig Schwierigkeiten beim Aufstehen, Hinken oder zeigen eine steife Gangart. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Rücken- oder Nackenbeschwerden kommen, und der Hund vermeidet oft Bewegungen wie Springen.
Ursachen: Spondylose tritt meist im Alter auf und ist häufig mit Abnutzung und Alterungsprozessen der Wirbelsäule verbunden. Auch Übergewicht, genetische Veranlagung oder frühere Verletzungen können das Risiko für Spondylose erhöhen. Diese Erkrankung betrifft vor allem ältere Hunde oder Hunde großer Rassen.
Vorbeugung: Eine ausgewogene Ernährung und die Kontrolle des Körpergewichts sind wichtig, um die Wirbelsäule nicht unnötig zu belasten. Regelmäßige, schonende Bewegung kann helfen, die Muskulatur zu stärken und die Wirbelsäule zu stabilisieren. Bei jungen Hunden sollte auf eine sanfte Entwicklung und das Vermeiden von schweren Belastungen geachtet werden.
Behandlung: Die Behandlung umfasst schmerzlindernde Medikamente und entzündungshemmende Mittel, um die Beschwerden zu lindern. Physiotherapie, gezielte Übungen und Gelenkmassagen können die Beweglichkeit fördern und Muskelverspannungen lösen. In schweren Fällen, wenn Nerven komprimiert werden, kann eine Operation in Erwägung gezogen werden. Ein angepasster Lebensstil mit weniger Belastung der Wirbelsäule kann helfen, die Lebensqualität des Hundes zu erhalten.
Mehr über Spondylose
Nieren- und Lebererkrankungen
Canine infektiöse Hepatitis
Symptome: Die Canine infektiöse Hepatitis (CIH) ist eine virale Erkrankung, die vor allem die Leber betrifft. Zu den typischen Symptomen gehören Fieber, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Gelbsucht (Gelbfärbung der Schleimhäute und Haut), Bauchschmerzen und eine allgemeine Schwäche. In schwereren Fällen können auch Blutgerinnungsstörungen, Schwellungen des Bauches und eine deutliche Apathie auftreten. Unbehandelt kann die Krankheit zum Leberversagen führen.
Ursachen: Die Erkrankung wird durch das Canine Adenovirus Typ 1 (CAV-1) verursacht. Das Virus wird hauptsächlich über den Kontakt mit infiziertem Urin, Speichel oder Kot übertragen. Häufig kommt es bei Welpen oder nicht geimpften Hunden zu Ausbrüchen, besonders in Tierheimen oder Zwingern.
Vorbeugung: Die beste Vorbeugung gegen Canine infektiöse Hepatitis ist die Impfung. Hunde sollten im Welpenalter geimpft werden, und regelmäßige Auffrischungsimpfungen sind wichtig, um einen langfristigen Schutz zu gewährleisten. Die Vermeidung von Kontakt mit möglicherweise infizierten Tieren und eine gute Hygiene im Umfeld sind ebenfalls empfehlenswert.
Behandlung: Eine spezifische antivirale Behandlung gegen das Canine Adenovirus gibt es nicht, daher konzentriert sich die Therapie auf die Linderung der Symptome und die Unterstützung der Leberfunktion. Dazu gehören Flüssigkeitszufuhr, Schmerzmanagement, Entgiftung und möglicherweise die Gabe von Leber unterstützenden Medikamenten. In schweren Fällen kann eine intensivmedizinische Betreuung erforderlich sein. Bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung haben Hunde gute Chancen auf eine vollständige Genesung.
Mehr über Hepatitis
Chronisches Nierenversagen (CNV)
Symptome: Langsame Verschlechterung der Nierenfunktion über Monate oder Jahre. Zu den Symptomen gehören vermehrtes Trinken, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Erbrechen, schlechter Fellzustand und lethargisches Verhalten. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Bluthochdruck und Anämie kommen.
Ursachen: Tritt meist im Alter auf und ist oft eine Folge von langjähriger Nierenkrankheit, bei der die Nieren langsam ihre Funktion verlieren. Ursachen sind unter anderem genetische Veranlagung, Harnwegserkrankungen, hohe Blutdruckwerte und Diabetes.
Vorbeugung: Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige tierärztliche Kontrolluntersuchungen (insbesondere bei älteren Hunden) und das Verhindern von Übergewicht können das Fortschreiten des Nierenversagens verlangsamen.
Behandlung: Es gibt keine Heilung, aber die Symptome können durch diätetische Anpassungen, Medikamente zur Blutdruckregulierung, Phosphatbindung und Vitaminpräparate kontrolliert werden. Eine spezielle Nierendiät hilft, die Nieren zu entlasten und das Fortschreiten zu verlangsamen. In schweren Fällen kann eine Nierenersatztherapie (z.B. Dialyse) erforderlich sein.
Mehr über chronisches Nierenversagen
Akutes Nierenversagen (ANV)
Symptome: Plötzlicher Verlust der Nierenfunktion, häufig begleitet von Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, starkem Durst, vermehrtem Wasserlassen (initial) oder fehlendem Wasserlassen (später), schwacher Atmung und allgemeiner Schwäche. In schweren Fällen kann es zu Schwellungen, insbesondere in den Beinen und im Gesicht, und zu einer schlechten Hautturgor (Haut, die langsamer zurückspringt) kommen.
Ursachen: Kann durch plötzliche Vergiftungen (z.B. Schokolade, Rattenköder), Dehydrierung, Harnwegsinfektionen, Traumata, Medikamente oder Infektionen verursacht werden. Auch Durchblutungsstörungen durch Herzprobleme oder niedrigen Blutdruck können zu akutem Nierenversagen führen.
Vorbeugung: Prävention umfasst das Vermeiden von toxischen Substanzen, regelmäßige ärztliche Untersuchungen und sicherstellen, dass der Hund immer ausreichend Wasser zur Verfügung hat. Vor allem ältere Hunde oder Hunde mit Vorerkrankungen sollten besonders gut überwacht werden.
Behandlung: Die Behandlung konzentriert sich auf die Beseitigung der zugrunde liegenden Ursache, Flüssigkeitszufuhr (Intravenös), Elektrolytgleichgewicht und gegebenenfalls Dialyse, um die Nierenfunktion zu unterstützen. Die Prognose ist besser, wenn das akute Nierenversagen frühzeitig erkannt und behandelt wird
Mehr über akutes Nierenversagen
Morbus Addison
Symptome: Morbus Addison (primäre Nebennierenrindeninsuffizienz) tritt auf, wenn die Nebennieren nicht genug Hormone wie Cortisol und Aldosteron produzieren. Symptome sind oft unspezifisch und können Müdigkeit, Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Dehydration, Muskelschwäche und Zittern umfassen. In akuten Fällen kann es zu einem Addison-Krisen kommen, die sich durch extreme Schwäche, Kreislaufschock und sogar Koma äußern kann.
Ursachen: Morbus Addison wird durch die Zerstörung des Gewebes der Nebennierenrinde verursacht, häufig aufgrund einer Autoimmunreaktion, bei der der Körper seine eigenen Nebennieren angreift. Weitere Ursachen können Infektionen, Tumoren oder genetische Erkrankungen sein.
Vorbeugung: Da Morbus Addison meist eine autoimmune Ursache hat, ist eine direkte Vorbeugung nicht möglich. Eine frühzeitige Diagnose und regelmäßige Kontrollen sind jedoch wichtig, um die Krankheit rechtzeitig zu erkennen und eine Krise zu vermeiden, insbesondere bei Hunden, die genetisch anfällig sind.
Behandlung: Die Behandlung von Morbus Addison erfolgt durch lebenslange Hormonersatztherapie, bei der die fehlenden Hormone (Cortisol und Aldosteron) ersetzt werden. Dies geschieht meist durch die Verabreichung von Medikamenten wie Prednisolon oder Fludrocortison. In Krisensituationen kann eine sofortige intravenöse Verabreichung von Flüssigkeiten und Hormonen erforderlich sein, um den Kreislauf zu stabilisieren. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen sind notwendig, um die richtige Dosierung und den Zustand des Hundes zu überwachen.
Mehr über Morbus Addison
Augenerkrankungen
Bindehautentzündung
Symptome: Eine Bindehautentzündung (Konjunktivitis) bei Hunden zeigt sich durch gerötete Augen, vermehrte Augenabsonderung (wässrig oder eitrig), häufiges Blinzeln oder Reiben des Auges. Der Hund kann auch empfindlich auf Licht reagieren, Augenlider können geschwollen oder verklebt sein, und der Hund zeigt möglicherweise Anzeichen von Unbehagen oder Schmerzen.
Ursachen: Bindehautentzündungen können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter Allergien, bakterielle oder virale Infektionen, Fremdkörper im Auge, trockene Augen (Keratokonjunktivitis sicca), Umwelteinflüsse wie Rauch oder Staub, oder durch Reizstoffe wie Shampoos oder chemische Substanzen. Auch Augenverletzungen oder eine mangelhafte Augenhygiene können eine Entzündung der Bindehaut verursachen.
Vorbeugung: Eine gute Augenhygiene, der Schutz vor Umweltfaktoren (z.B. Staub, Rauch), sowie die regelmäßige Kontrolle auf Fremdkörper im Auge können helfen, eine Bindehautentzündung zu verhindern. Bei Hunden mit Allergien ist es wichtig, allergieauslösende Stoffe zu vermeiden und bei Bedarf eine spezifische Behandlung durch den Tierarzt zu erhalten.
Behandlung: Die Behandlung einer Bindehautentzündung hängt von der Ursache ab. Bei bakteriellen Infektionen werden meist Antibiotika-Augentropfen oder -salben verabreicht. Bei viralen Infektionen ist die Behandlung symptomatisch, während bei allergischen Reaktionen Antihistaminika oder kortisonhaltige Präparate helfen können. In einigen Fällen, etwa bei Fremdkörpern, muss der Tierarzt diese entfernen. Eine frühzeitige Behandlung ist wichtig, um Komplikationen wie Hornhautveränderungen oder chronische Entzündungen zu verhindern.
Hornhautdefekt
Symptome: Ein Hornhautdefekt (Keratitis) bei Hunden äußert sich durch Rötung, Tränenfluss, Augenverletzungen, häufiges Blinzeln und Augenschmerzen. Der Hund kann das betroffene Auge schließen oder reiben und eine vermehrte Lichtempfindlichkeit zeigen. In schweren Fällen kann es zu einer weißen Trübung auf der Hornhaut kommen.
Ursachen: Hornhautdefekte entstehen meist durch Verletzungen oder Kratzer (z.B. durch Fremdkörper, Krallen oder Stöße), aber auch durch Infektionen (bakterielle, virale oder pilzliche) oder Entzündungen. Trockene Augen oder die falsche Behandlung von Augenkrankheiten können ebenfalls zu Hornhautdefekten führen.
Vorbeugung: Um Hornhautverletzungen vorzubeugen, sollte der Hund vor Fremdkörpern, Staub und anderen Umwelteinflüssen geschützt werden. Auch regelmäßige Augenuntersuchungen, besonders bei Hunden mit trockenen Augen oder anderen Augenproblemen, können helfen, die Entstehung von Hornhautdefekten frühzeitig zu erkennen.
Behandlung: Die Behandlung hängt von der Ursache des Defekts ab. Bei Verletzungen oder oberflächlichen Kratzern werden oft antibiotische Salben oder Tropfen verschrieben, um Infektionen zu verhindern und die Heilung zu fördern. Bei tieferen Defekten oder Infektionen kann eine intensivere Behandlung mit speziellen Augentropfen oder sogar chirurgische Eingriffe notwendig sein. In schwereren Fällen kann auch eine Schutzlinse oder ein Verband zur Heilung beitragen. Eine frühzeitige Behandlung ist entscheidend, um dauerhafte Schäden oder Sehstörungen zu vermeiden.
Grüner Star (Glaukom)
Symptome: Grüner Star (Glaukom) bei Hunden führt zu erhöhtem Augeninnendruck, was zu Schmerzen und Schäden am Sehnerv führen kann. Symptome sind Rötung des Auges, Tränenfluss, Vergrößerung der Pupille, verschwommenes oder trübes Sehen, Augenblinzeln oder -reiben. In fortgeschrittenen Fällen kann der Hund Schwierigkeiten beim Sehen haben und Orientierung verlieren, was zu Unsicherheit beim Laufen führt. Auch das Auge kann sich sichtbar vergrößern oder hervorquellen.
Ursachen: Glaukom entsteht, wenn der Augeninnendruck zu stark ansteigt, oft aufgrund einer Blockade des Abflusses von Kammerwasser (Flüssigkeit im Auge). Dies kann durch genetische Veranlagung, Entzündungen, Augenverletzungen oder Tumoren ausgelöst werden. In seltenen Fällen kann es auch als Nebenwirkung bestimmter Medikamente auftreten.
Vorbeugung: Eine direkte Vorbeugung gegen Glaukom ist schwierig, insbesondere bei Hunden mit genetischer Veranlagung. Regelmäßige Augenuntersuchungen, besonders bei Hunden, die zu Augenerkrankungen neigen (z.B. Cocker Spaniels, Huskys), können helfen, die Krankheit frühzeitig zu erkennen und eine Behandlung einzuleiten.
Behandlung: Die Behandlung des Glaukoms zielt darauf ab, den Augeninnendruck zu senken. Dies kann durch Augentropfen erfolgen, die die Produktion von Kammerwasser verringern oder den Abfluss verbessern. In schweren Fällen oder bei fehlender Wirkung von Medikamenten kann eine Operation notwendig sein, wie beispielsweise ein Eingriff zur Verbesserung des Abflusses von Kammerwasser oder die Entfernung des Auges, wenn es nicht gerettet werden kann. Eine frühzeitige Diagnose und schnelle Behandlung sind entscheidend, um den Sehverlust zu vermeiden.
Grauer Star (Katarakt)
Symptome: Grauer Star (Katarakt) ist eine Trübung der Augenlinse, die zu einer allmählichen Verschlechterung des Sehvermögens führt. Hunde mit grauem Star zeigen Symptome wie das Hinken oder das Scheuen vor Dunkelheit, Schwierigkeiten beim Erkennen von Gegenständen oder Hindernissen, vermehrtes Blinzeln und ein milchiger oder trübe erscheinender Pupillenbereich. In fortgeschrittenen Fällen kann der Hund blind werden.
Ursachen: Die häufigste Ursache für grauen Star ist das Alter (seniler Katarakt), bei der die Linse der Augen mit der Zeit trüb wird. Andere Ursachen sind genetische Veranlagung (z.B. bei Rassen wie Pudel oder Terrier), Diabetes mellitus (wodurch der Katarakt schneller entstehen kann), Augenverletzungen oder Entzündungen. In einigen Fällen kann auch eine langfristige Behandlung mit bestimmten Medikamenten (z.B. Kortikosteroiden) zu einem grauen Star führen.
Vorbeugung: Eine direkte Vorbeugung gegen grauen Star ist schwierig, besonders bei genetischer Veranlagung oder altersbedingten Veränderungen. Eine frühzeitige Diagnose von Diabetes und die Kontrolle von anderen Erkrankungen, die das Auge betreffen, können jedoch helfen, das Risiko zu verringern. Eine regelmäßige Augenuntersuchung ist besonders für ältere Hunde oder Hunde mit bestimmten Risikofaktoren wichtig.
Behandlung: Die einzige Möglichkeit, den grauen Star zu behandeln, besteht in einer Operation, bei der die trübe Linse entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt wird. Diese Operation ist eine der häufigsten Augenoperationen bei Hunden und hat eine gute Prognose, insbesondere bei jüngeren Tieren. In Fällen von Diabetes ist es wichtig, die zugrunde liegende Erkrankung zu behandeln, um das Fortschreiten des Katarakts zu verlangsamen. In weniger schweren Fällen, bei denen der Hund noch in der Lage ist zu sehen, können Anpassungen im Alltag helfen, um die Lebensqualität zu verbessern.
Herzkrankheiten
DCM (Dilative Cardiomyopathy)
Symptome: DCM (Dilative Cardiomyopathy) ist eine Herzkrankheit, die vor allem die Herzmuskeln betrifft und zu einer schlechten Pumpfunktion des Herzens führt. Symptome können Husten, schnelle oder flache Atmung, Müdigkeit, Leistungsabfall, eine allgemeine Schwäche, Flüssigkeitsansammlungen im Bauch (Aszites) oder in den Beinen sowie eine verminderten Appetit sein. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu einer Herzinsuffizienz und Ohnmachtsanfällen kommen.
Ursachen: DCM ist eine genetisch bedingte Krankheit, die vor allem große Rassen wie Dobermann, Boxer, Doggen und Rottweiler betrifft. Sie führt dazu, dass der Herzmuskel sich dehnt und schwächer wird, was die Fähigkeit des Herzens verringert, Blut effizient durch den Körper zu pumpen. In seltenen Fällen kann DCM auch durch Infektionen, Nährstoffmangel oder andere Erkrankungen ausgelöst werden.
Vorbeugung: Da DCM oft genetisch bedingt ist, ist eine direkte Vorbeugung schwierig. Züchter können jedoch verantwortungsbewusst selektieren, um das Risiko in bestimmten Rassen zu minimieren. Ein gesunder Lebensstil, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und eine ausgewogene Ernährung können helfen, das Risiko zu verringern und das Fortschreiten zu verzögern, besonders wenn es frühzeitig erkannt wird.
Behandlung: Die Behandlung von DCM konzentriert sich auf die Verbesserung der Herzfunktion und die Linderung der Symptome. Häufig kommen Medikamente wie ACE-Hemmer, Diuretika (um Flüssigkeit zu reduzieren), Beta-Blocker und Herzglykoside zum Einsatz, die helfen, das Herz zu entlasten und die Pumpleistung zu stabilisieren. In einigen Fällen sind auch Nahrungsergänzungsmittel wie Taurin und L-Carnitin hilfreich. In fortgeschrittenen Fällen, bei schwerer Herzinsuffizienz, kann eine spezielle chirurgische Behandlung oder eine Herztransplantation notwendig sein. Ein frühzeitiger Behandlungsbeginn verbessert die Lebensqualität und kann das Fortschreiten der Krankheit verzögern.
Krebs
Cushing Syndrom (Morbus Cushing)
Symptome: Das Cushing-Syndrom (Morbus Cushing) bei Hunden wird durch eine Überproduktion von Cortisol verursacht, was zu einer Reihe von Symptomen führen kann. Zu den häufigsten gehören erhöhter Durst (Polydipsie), vermehrtes Urinieren (Polyurie), Appetitsteigerung, Gewichtszunahme, besonders im Bereich des Bauchs, und dünner werdendes Fell. Weitere Anzeichen sind eine dünnere Haut, eine erhöhte Infektanfälligkeit, schwaches Wachstum von Fell und Krallen sowie Muskelschwund. In schwereren Fällen kann es zu Diabetes mellitus, Bluthochdruck und Hautveränderungen kommen.
Ursachen: Das Cushing-Syndrom tritt am häufigsten aufgrund eines Tumors in der Hypophyse (der Hirnanhangsdrüse) auf, der die Produktion von ACTH (adrenocorticotropes Hormon) steigert, welches die Nebennieren zur Cortisolproduktion anregt. Eine andere mögliche Ursache ist ein Tumor in der Nebennierenrinde selbst, der direkt zu einer Überproduktion von Cortisol führt. Weniger häufig kann es durch die langfristige Verabreichung von Kortikosteroiden als Medikament (z.B. zur Behandlung von Entzündungen) entstehen.
Vorbeugung: Eine direkte Vorbeugung gegen das Cushing-Syndrom ist schwierig, insbesondere wenn es genetische Ursachen hat. Bei Hunden, die langfristig Kortikosteroide benötigen, sollte die Dosierung regelmäßig überprüft und nach Möglichkeit reduziert werden, um das Risiko einer medikamenteninduzierten Form zu minimieren.
Behandlung: Die Behandlung des Cushing-Syndroms hängt von der Ursache ab. Bei einem Tumor in der Hypophyse wird häufig eine medikamentöse Therapie mit speziellen Medikamenten wie Trilostan oder Mitotane eingesetzt, die die Produktion von Cortisol verringern. Bei Tumoren in den Nebennieren kann eine chirurgische Entfernung des Tumors in Erwägung gezogen werden. In einigen Fällen kann auch eine Strahlentherapie notwendig sein. Eine lebenslange Behandlung und regelmäßige Überwachung der Blutwerte sind oft erforderlich, um den Zustand unter Kontrolle zu halten und die Lebensqualität des Hundes zu verbessern.
Entzündungen und Abszesse
Abszess
Symptome: Ein Abszess bei Hunden ist eine Ansammlung von Eiter in einem Gewebe, die häufig mit einer schmerzhaften Schwellung, Rötung und Wärme verbunden ist. Der betroffene Bereich kann empfindlich sein, und der Hund zeigt oft Anzeichen von Unbehagen, wie das Lecken oder Kratzen der betroffenen Stelle. In schwereren Fällen kann es zu Fieber, Appetitlosigkeit und einer allgemeinen Abgeschlagenheit kommen, wenn die Infektion fortschreitet.
Ursachen: Abszesse entstehen meist durch bakterielle Infektionen, die nach einer Verletzung oder durch einen Fremdkörper wie einen Splitter in die Haut eindringen. Auch infizierte Bisse, Kratzer oder Wunden können zu Abszessen führen. In einigen Fällen kann eine entzündliche Erkrankung oder eine unzureichende Heilung nach einer Operation zu Abszessen führen.
Vorbeugung: Die beste Vorbeugung besteht darin, Wunden und Verletzungen sauber zu halten und zu desinfizieren, um das Eindringen von Bakterien zu verhindern. Zudem sollte man darauf achten, dass der Hund nicht in Kontakt mit schmutzigen oder infizierten Bereichen kommt, die zu einer Verletzung führen könnten. Eine regelmäßige Hautpflege und -kontrolle kann helfen, kleinere Infektionen frühzeitig zu erkennen.
Behandlung: Abszesse erfordern in der Regel eine Entwässerung durch den Tierarzt, bei der der Eiter entfernt wird. Dies geschieht meist durch einen kleinen Schnitt und eine gründliche Reinigung. In einigen Fällen werden auch antibiotische Medikamente verschrieben, um die Infektion zu bekämpfen. Wenn ein Fremdkörper die Ursache des Abszesses ist, muss dieser ebenfalls entfernt werden. Bei wiederkehrenden Abszessen oder schweren Infektionen kann eine langfristige Behandlung erforderlich sein. In den meisten Fällen heilt der Abszess schnell und ohne weitere Komplikationen, wenn er rechtzeitig behandelt wird.
Analdrüsenentzündung
Symptome: Eine Analdrüsenentzündung tritt auf, wenn die Drüsen, die sich neben dem After des Hundes befinden, blockiert oder infiziert sind. Symptome sind häufiges Schlittenfahren (Schleifen des Gesäßes auf dem Boden), Lecken oder Beißen des Anusbereichs, Rötung und Schwellung rund um den After. In schwereren Fällen kann es zu Eiterabsonderungen, unangenehmem Geruch oder Schmerzen kommen. Der Hund kann auch Anzeichen von Unbehagen zeigen, wie z.B. das Sitzen auf den Hinterbeinen oder das Vermeiden von Bewegungen.
Ursachen: Die häufigste Ursache für eine Analdrüsenentzündung ist eine Verstopfung oder Blockierung der Analdrüsen, oft aufgrund von zu dickem oder zu weichem Stuhl. Dies kann durch eine unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel oder eine unzureichende Entleerung der Drüsen bei der Defäkation verursacht werden. Auch bakterielle Infektionen, Entzündungen oder Verletzungen der Analregion können zu einer Entzündung der Drüsen führen.
Vorbeugung: Eine ausgewogene Ernährung, die den Stuhl des Hundes in eine mittelfeste Konsistenz bringt, kann dazu beitragen, eine Verstopfung der Analdrüsen zu verhindern. Regelmäßige Bewegung fördert eine gesunde Verdauung und hilft, die Drüsen auf natürliche Weise zu entleeren. Einige Hunde benötigen regelmäßige analdrüsenentleerungen beim Tierarzt, besonders wenn sie anfällig für Entzündungen sind.
Behandlung: Bei einer Analdrüsenentzündung wird der Tierarzt die betroffenen Drüsen in der Regel manuell entleeren, um den Druck zu verringern und das angesammelte Sekret zu entfernen. In schweren Fällen, in denen eine Infektion vorliegt, kann eine antibiotische Behandlung erforderlich sein. Wenn die Entzündung wiederholt auftritt oder chronisch wird, kann es notwendig sein, die Drüsen chirurgisch zu entfernen. Eine regelmäßige Kontrolle und Pflege der Analregion durch den Tierarzt kann helfen, weiteren Problemen vorzubeugen.
Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis)
Symptome: Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis) bei Hunden äußert sich durch Symptome wie plötzlichen Appetitverlust, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen (oft begleitet von einer Zwangshaltung, bei der der Hund seinen Rücken krümmt), allgemeine Schwäche, Fieber und Dehydration. Der Hund kann außerdem lethargisch wirken und weniger aktiv sein.
Ursachen: Pankreatitis entsteht, wenn die Bauchspeicheldrüse, die Verdauungsenzyme produziert, entzündet wird. Dies kann durch fettreiche Mahlzeiten, die zu einer Überlastung der Bauchspeicheldrüse führen, ausgelöst werden. Auch bestimmte Medikamente, Infektionen, hormonelle Störungen (wie Diabetes mellitus) oder Traumata können Ursachen sein. Genetische Veranlagung und Übergewicht erhöhen ebenfalls das Risiko.
Vorbeugung: Um einer Pankreatitis vorzubeugen, sollte eine fettarme, ausgewogene Ernährung gefüttert werden. Übergewicht sollte vermieden und die Ernährung des Hundes regelmäßig angepasst werden, um Verdauungsstörungen zu vermeiden. Es ist auch wichtig, keine ungeeigneten Lebensmittel wie fettige Reste oder menschliche Nahrungsmittel zu geben.
Behandlung: Die Behandlung einer Pankreatitis umfasst in der Regel die stationäre Behandlung, insbesondere bei schweren Fällen. Dazu gehören Flüssigkeitstherapien zur Bekämpfung der Dehydration, die Gabe von Schmerzmitteln und Entzündungshemmern sowie die vorübergehende Ernährungskontrolle, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten. In schweren Fällen, bei Komplikationen wie einer Infektion, können zusätzliche Medikamente erforderlich sein. Nach der Genesung muss auf eine angepasste Ernährung geachtet werden, um Rückfälle zu vermeiden.
Blasenentzündung (Cystitis)
Symptome: Eine Blasenentzündung (Cystitis) bei Hunden zeigt sich durch häufiges Urinieren, das oft mit Schmerzen verbunden ist. Der Hund kann beim Wasserlassen Winseln oder Anzeichen von Unbehagen zeigen. Der Urin kann trüb oder blutig sein, und es können Unfälle auftreten, insbesondere wenn der Hund die Blase nicht vollständig entleeren kann. In schweren Fällen kann der Hund auch Fieber, Appetitlosigkeit und allgemeine Schwäche zeigen.
Ursachen: Cystitis wird häufig durch bakterielle Infektionen verursacht, kann aber auch durch Harnsteine, Tumore, Verletzungen, oder eine Reizung der Blase durch Medikamente oder Fremdkörper ausgelöst werden. Auch Hormonstörungen, wie eine Blasenschwäche bei älteren Hunden oder Diabetes mellitus, können das Risiko erhöhen.
Vorbeugung: Eine regelmäßige Hydratation, besonders bei Hunden, die zu Harnwegsproblemen neigen, hilft, die Blase regelmäßig zu entleeren und das Risiko einer Infektion zu verringern. Die regelmäßige Reinigung von Toilettenbereichen sowie das Vermeiden von langem Zurückhalten des Urins sind ebenfalls wichtige Vorbeugungsmaßnahmen. Bei Hunden mit wiederkehrenden Infektionen sollten diese regelmäßig tierärztlich untersucht werden.
Behandlung: Die Behandlung einer Cystitis besteht meistens in der Gabe von Antibiotika, um die Infektion zu bekämpfen. Wenn Harnsteine oder Tumore die Ursache sind, müssen diese gegebenenfalls chirurgisch entfernt oder durch eine spezielle Diät behandelt werden. Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente können zur Linderung der Symptome eingesetzt werden. Es ist wichtig, die Behandlung vollständig abzuschließen, um Rückfälle zu vermeiden. Eine angepasste Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr helfen, die Blase gesund zu halten.
Nervenkrankheiten
Depression
Symptome: Eine Depression bei Hunden äußert sich oft durch Verhaltensänderungen, wie reduzierte Aktivität, vermehrte Schläfrigkeit oder das Ignorieren von Spiel oder Interaktionen. Hunde können auch Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, übermäßiges Lecken oder Kratzen, und eine verminderte Reaktion auf alltägliche Reize zeigen. Manche Hunde ziehen sich zurück, haben weniger Interesse an Spaziergängen oder gewohnten Aktivitäten und wirken apathisch oder traurig.
Ursachen: Depressionen bei Hunden können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, wie etwa den Verlust eines geliebten Familienmitglieds (Mensch oder anderes Haustier), plötzliche Änderungen im Umfeld (Umzug, neue Haustiere, neue Besitzer), chronische Schmerzen oder gesundheitliche Probleme, eine mangelnde Stimulation oder übermäßige Isolation. Auch hormonelle Ungleichgewichte, besonders bei älteren Hunden, können eine Rolle spielen.
Vorbeugung: Eine stabile, stressfreie Umgebung mit regelmäßiger Bewegung und sozialer Interaktion kann helfen, Depressionen bei Hunden vorzubeugen. Auch eine ausgewogene Ernährung, die reich an Nährstoffen ist, kann das allgemeine Wohlbefinden fördern. Es ist wichtig, auf Anzeichen von Stress oder Unwohlsein bei einem Hund zu achten und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen.
Behandlung: Die Behandlung von Depressionen bei Hunden umfasst oft eine Kombination aus Verhaltensänderungen und, falls nötig, einer medizinischen Therapie. Es kann hilfreich sein, den Hund mit neuen, anregenden Aktivitäten oder Spielzeugen zu beschäftigen und ihn in seiner sozialen Umgebung zu unterstützen. In einigen Fällen kann der Tierarzt Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel verschreiben, die helfen, die Stimmung zu stabilisieren, insbesondere wenn die Depression mit einem hormonellen Ungleichgewicht zusammenhängt. Es ist wichtig, regelmäßig mit einem Tierarzt zu sprechen, um die beste Vorgehensweise für die individuelle Situation des Hundes zu finden.
Epilepsie
Symptome: Epilepsie bei Hunden äußert sich in wiederkehrenden Anfällen, die plötzlich auftreten und oft ohne Vorwarnung. Während eines Anfalls kann der Hund unkontrollierbare Zuckungen oder Krämpfe haben, sich auf den Boden werfen, sabbern oder das Bewusstsein verlieren. Manchmal kommt es zu unwillkürlichem Urinieren oder Stuhlgang. Zwischen den Anfällen kann der Hund völlig normal wirken. Einige Hunde zeigen vor einem Anfall auch veränderte Verhaltensweisen, wie Unruhe oder nervöses Verhalten.
Ursachen: Epilepsie bei Hunden kann genetisch bedingt sein, insbesondere bei bestimmten Rassen wie dem Beagle, Labrador Retriever oder Border Collie. In anderen Fällen kann sie durch Hirnverletzungen, Tumore, Infektionen, Stoffwechselstörungen oder eine Vergiftung ausgelöst werden. Manchmal bleibt die genaue Ursache jedoch unbekannt, was als idiopathische Epilepsie bezeichnet wird.
Vorbeugung: Eine direkte Vorbeugung von Epilepsie ist schwierig, besonders bei genetischer Veranlagung. Für Hunde, bei denen eine bekannte Ursache wie eine Infektion oder ein Trauma vorliegt, kann eine frühzeitige Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung das Risiko von Anfällen verringern. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen helfen dabei, gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Behandlung: Epilepsie wird häufig mit Medikamenten behandelt, die helfen, die Häufigkeit und Schwere der Anfälle zu verringern. Zu den gebräuchlichsten Medikamenten gehören Phenobarbital und Kaliumbromid. In einigen Fällen können auch andere Medikamente wie Levetiracetam oder Zonisamid zum Einsatz kommen. Eine regelmäßige Überwachung der Medikamentendosierung und Blutwerte ist wichtig, um Nebenwirkungen zu vermeiden und die bestmögliche Kontrolle der Anfälle zu gewährleisten. In seltenen Fällen, bei sehr häufigen oder schwerwiegenden Anfällen, kann eine spezielle Behandlung wie eine ketogene Diät oder sogar eine Operation in Erwägung gezogen werden.
Scheinträchtigkeit (Pseudogravidität)
Symptome: Eine Scheinträchtigkeit (Pseudogravidität) bei Hunden tritt auf, wenn eine nicht trächtige Hündin Symptome einer echten Schwangerschaft zeigt. Diese können unter anderem eine vergrößerte, empfindliche Brust, vermehrtes Nestbauverhalten, Appetitveränderungen (häufige Fresslust oder Appetitlosigkeit), vermehrtes Lecken des Bauchbereichs und sogar eine Gewichtszunahme umfassen. In einigen Fällen kann die Hündin auch eine scheinbare Zuneigung zu Spielzeugen oder Gegenständen zeigen, die sie wie Welpen behandelt. Es ist auch möglich, dass es zu milden Symptomen wie depressiver Stimmung oder Reizbarkeit kommt.
Ursachen: Scheinträchtigkeit wird durch hormonelle Veränderungen ausgelöst, die nach einer Läufigkeit auftreten. Auch ohne eine tatsächliche Schwangerschaft werden ähnliche Hormone wie Progesteron produziert, die die Symptome einer Schwangerschaft verursachen. Obwohl dies bei vielen Hündinnen in der Natur vorkommen kann, tritt es häufiger bei bestimmten Rassen und älteren Hündinnen auf.
Vorbeugung: Eine direkte Vorbeugung gegen Scheinträchtigkeit ist schwer möglich. Bei Hündinnen, die häufig darunter leiden, kann eine Kastration eine langfristige Lösung darstellen, um die hormonellen Schwankungen, die die Pseudogravidität auslösen, zu verhindern. Es ist auch hilfreich, die Hündin während der Läufigkeit besonders zu beobachten, um frühzeitig mit einer Behandlung beginnen zu können.
Behandlung: In vielen Fällen heilt eine Scheinträchtigkeit von selbst ohne medizinische Intervention. In schwereren Fällen, bei ausgeprägten Symptomen, kann der Tierarzt hormonelle Behandlungen oder Medikamente empfehlen, um die Symptome zu lindern. Auch eine Ernährungsumstellung oder die Vermeidung von Nestbauaktivitäten kann helfen, die Anzeichen zu mildern. Bei wiederholten oder besonders belastenden Fällen kann eine Kastration in Betracht gezogen werden, um das Problem dauerhaft zu lösen.
Allergien
Futtermittelallergie
Symptome: Eine Futtermittelallergie bei Hunden zeigt sich oft durch Hautprobleme wie Juckreiz, Rötungen, Haarausfall, und entzündete oder verkrustete Stellen. Auch Ohrentzündungen, Verdauungsstörungen (wie Durchfall oder Erbrechen) und häufiges Lecken an Pfoten oder anderen Körperstellen können Anzeichen einer Futtermittelallergie sein. Bei einigen Hunden können auch Atembeschwerden auftreten. Die Symptome treten meist nach dem Verzehr bestimmter Nahrungsmittel auf.
Ursachen: Futtermittelallergien entstehen, wenn das Immunsystem des Hundes überreagiert und bestimmte Bestandteile im Futter als Bedrohung identifiziert. Am häufigsten sind Proteine wie Rindfleisch, Huhn, Getreide (insbesondere Weizen) oder Milchprodukte die Auslöser. Allergien entwickeln sich häufig nach längerer Fütterung des gleichen Futters, können jedoch auch plötzlich auftreten, selbst wenn der Hund vorher keine Probleme hatte.
Vorbeugung: Um eine Futtermittelallergie zu vermeiden, ist es wichtig, den Hund mit einer ausgewogenen, hochwertigen Ernährung zu versorgen und auf unverträgliche Inhaltsstoffe zu achten. Besonders bei Hunden, die zu Allergien oder Hautproblemen neigen, sollten Sie auf hypoallergene oder monoproteinelle Futtermittel zurückgreifen, die weniger potentielle Allergene enthalten.
Behandlung: Die Behandlung einer Futtermittelallergie erfolgt meist durch die Umstellung auf ein geeignetes Futter, das keine bekannten Allergene enthält. Häufig wird eine Ausschlussdiät empfohlen, bei der der Hund nur ein einziges, neues Protein und eine neue Kohlenhydratquelle erhält, um den Auslöser zu identifizieren. In einigen Fällen können auch Medikamente zur Linderung von Juckreiz und Entzündungen verschrieben werden. In schwereren Fällen kann eine Immuntherapie erwogen werden, um die Reaktion des Immunsystems zu verringern.
Umweltallergie
Symptome: Eine Umweltallergie bei Hunden äußert sich vor allem durch Hautprobleme wie Juckreiz, Rötungen, Entzündungen und Haarausfall, besonders an den Pfoten, Ohren, Bauch und im Gesicht. Die betroffenen Stellen können sich auch infizieren und nässen. Hunde neigen auch dazu, sich häufig zu lecken oder zu kratzen, was die Symptome verschärfen kann. Weitere Anzeichen sind häufige Ohrentzündungen, Schnupfen oder Husten, besonders bei Pollenallergien. In einigen Fällen kann auch eine verstärkte Tränenproduktion auftreten.
Ursachen: Umweltallergien werden durch Substanzen ausgelöst, die in der Umgebung des Hundes vorkommen, wie Pollen, Hausstaubmilben, Schimmelsporen, Gräser, Bäume oder bestimmte chemische Stoffe in Haushaltsreinigern. Diese Allergien entstehen, wenn das Immunsystem des Hundes überempfindlich auf diese Umweltfaktoren reagiert.
Vorbeugung: Eine vollständige Vorbeugung ist schwierig, da Umweltfaktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dennoch kann das regelmäßige Reinigen des Hauses, das Waschen des Hundes nach Spaziergängen in pollenreichen Gebieten und das Vermeiden von bekannten Auslösern helfen. In besonders belasteten Gebieten kann es sinnvoll sein, die Spaziergänge während der Hauptpollenflugzeiten zu reduzieren.
Behandlung: Die Behandlung einer Umweltallergie besteht häufig in der Verwendung von Antihistaminika oder entzündungshemmenden Medikamenten wie Steroiden, um die Symptome zu lindern. In schwereren Fällen können Immuntherapien (Allergen-Impfungen) helfen, das Immunsystem des Hundes auf die Allergene zu desensibilisieren. Auch eine regelmäßige Hautpflege, wie das Baden mit speziellen, beruhigenden Shampoos, kann helfen, die Haut zu beruhigen und Entzündungen zu lindern.